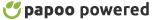Gendersprache - eine sprachpolitische Sackgasse ?
Ein Kommentar von Hubert Hecker
In Deutschland wird seit 40 Jahren die Gender-Sprachpolitik vorangetrieben, Inzwischen haben einige Universitäten, Stadtverwaltungen und andere Institutionen Anleitungen herausgegeben, mit denen sie ihren „Mitarbeiter*innen“ die Gendersprache „empfehlen“, faktisch jedoch aufnötigen. In der EKD ist seit kurzem das Gendern quasi vorgeschrieben.
In Publikationen aus dem Bereich der katholischen Kirche ist die Gendersprache noch nicht so verbreitet. Aber einzelne Organisationen haben sich ihr verschrieben – so das Zentralkomitee der Katholiken, der BDKJ und Misereor. Auch Einzelpersonen betätigen sich als Genderaktivisten. Dazu zählen Laienteilnehmer des Synodalen Wegs oder die Gastprofessorin Dr. Sonja Strube an der Katholischen Hochschule Mainz. Sie hält Seminare ab gegen „Anti-Gender-Aktivismus“ im konservativen Bereich der Kirche. Dort seien „Frauen die bekanntesten Wortführer*innen“, meint Frau Strube in einem Interview der Mainzer Kirchenzeitung ‚Glauben und Leben‘ vom 10. Januar 2021.
Eine Pastoralreferentin aus dem Bistum verwendete in ihren Texten zum Pfarrbrief die Anrede: „Liebe Mitchrist*innen“. Bei einem Gottesdienst sprach sie die versammelten Gläubigen als „Liebe Mitchrist innen“ an, also mit einer künstlichen Wortinnenpause. Auf den kritischen Einwand, dass mit ihrer Christinnen-Anrede die männlichen Christen sprachlich ausgeschlossen würden, ging sie nicht ein, sondern verwies auf ihre subjektiven Intentionen: In ihrer Anrede mit der Genderpause habe sie doch die liebende Perspektive der Inklusion ausdrücken wollen, bei der „sich jede*r (männlich/weiblich/divers) hier in der Gemeinde willkommen geheißen fühlen soll“.
Ähnliche Rechtfertigungen gab es kürzlich zu einem Vorfall in München. Der Pressesprecher des Erzbistums München-Freising hatte auf Twitter eine Mitteilung über neue „Kirchenmusiker*innen“ gesendet. Auf die anschließende Empörungswelle über seine Gendersprache reagierte er gereizt, indem er die „Kritik an den Gepflogenheiten im Erzbistum von Kardinal Reinhard Marx“ als „dämlich“ abkanzelte, also mit einem pejorativen Ausdruck für weibliches Verhalten. Im Gespräch mit der Verlagsgruppe Bistumspresse polterte er: Es seien „fundamentalistische Strömungen in den sozialen Medien“, die den Genderstern und anderes „vermeintlich modernistisches und angepasstes Amtskirchen“-Verhalten skandalisieren würden. Dabei bemühe sich das Erzbistum doch lediglich, „eine wertschätzende Sprache zu verwenden, alle Menschen, egal ob weiblich, männlich oder divers, mitzunehmen“[1]. Mit der inklusiven Sprache sollten soziale Ausgrenzungen vermieden werden.
Man fragt sich: Soll man sich mehr wundern
- über das selbstgefällige Gesinnungslob,
- die Naivität gegenüber den Zielen des Genderismus oder
- die Ignoranz zur Struktur der Sprache?
Auch die Implikationen der oben genannten Intentionen, nach denen die deutsche Sprache ohne Genderstern ausgrenzend, nicht wertschätzend und geschlechterungerecht wäre, sind als ignorante Falschannahmen anzusehen. Bei dem erzbischöflichen Pressesprecher ebenso wie dem Redakteur der Bistumspresse könnte ein Grundkurs zu den Wortbildungsgesetzen der deutschen Sprache ihre Wissenslücken und Fehleinschätzungen beseitigen:
Die große Wortklasse der Nomina mit der Endung -er werden durch Substantivierung von Verben gebildet: Aus lesen, beten, wählen, mieten etc. werden Leser, Beter, Wähler, Mieter. Die Substantive stehen zwar im Maskulinum. Doch ebenso wie für das jeweilige Handeln ist auch bei den Handelnden das Geschlecht (Sexus) irrelevant. Die Artikel und Nomina werden für die gesamte Gattung oder Klasse der Agierenden gebraucht und mit dem lateinischen Begriff Genus bezeichnet. Man spricht in diesem Fall von generischem Maskulinum, das geschlechtsindifferent Männer und Frauen einschließt. Der Inklusionscharakter von Genera wird besonders deutlich bei der Pluralbildung: Mit den Worten ‚die Leser, die Beter, die Wähler, die Mieter‘ werden unter dem generischen Feminin-Artikel weibliche und männliche Akteure zusammengefasst – etwa in den Sätzen: ‚Die Wohnungsmieter sind Helga und Gerd Wiese‘ oder: ‚Die meisten Beter in Lourdes sind Frauen‘. Auch in den Wortableitungen und Komposita wie Leserschaft‚ Wählerverzeichnis, Mieterversammlung, Kundenberatung oder Kanzleramt werden die Maskulinworte generisch-inklusiv verwendet.
Gleiche Bestimmungen gelten für die maskulinen Substantive mit den Endungen -ist (z. B. Realist, Christ), -ant (Migrant, Lieferant), -eur (Redakteur) und -or (Lektor). Sie werden hauptsächlich als Genera gebraucht. Die Bezeichnungen Christ oder Migrant schließen Männer und Frauen ein – etwa in den Wendungen: ‚Christ in der Gegenwart‘ oder ‚Die Migranten von 2015 waren zu 30 Prozent weiblich‘. Gleichwohl sind sie aber auch je nach Kontext mit Sexusbezug verwendbar – etwa: ‚Ein Christ betrügt niemals seine Frau‘ oder ‚Migranten aus Nordafrika haben vielfach ein archaisches Frauenbild‘.
Das Fachwort für die semantische Geschlechtervariabilität heißt ‚unmarkiert‘. Das bedeutet: Die Maskulin-Worte mit Suffixen auf -er, -ist, -ant etc. sind nicht auf das Merkmal ‚männlich‘ festgelegt. Dieses fundamentale Sprachgesetz will der Duden neuerdings aushebeln, indem er die oben genannten Wortklassen in Singular und Plural als männlich fixiert dekretiert. Der generische Gebrauch der Worte Wähler, Mieter, Christ etc., wie oben an Beispielen dargestellt, soll künftig als regelwidrig angesehen werden. Die Folge wäre, dass die Begriffe Christsein, Christlichkeit oder Christenverfolgung in ihrem Bedeutungsbezug ausschließlich für Männer reserviert wären. Der Verwirr-Duden will uns vorschwindeln, als wenn eine Kundenberaterin nicht für weibliche Kunden zuständig wäre, zu einer Mieterversammlung Frauen keine Einladung hätten und im Wählerverzeichnis nur Männer gelistet wären. Nach der neuen Duden-Willkür müsste der Plural stets gegendert werden z. B. zu Lehrer- und Lehrerinnenzimmer oder Genossen- und Genossinnenschaft. Die Folge dieser Verumständlichung der Sprache führt dazu, dass es in den Reden von gendereifrigen Politikern regelmäßig zum ‚geschlechterungerechten‘ Vernuscheln der weiblichen Formen kommt – etwa zu Genossen’n (O. Scholz) oder Soldaten’n (H. Maas).
Diese Defizite der Gendersprache zeigen die kommunikative Sinnhaftigkeit, insbesondere im Plural sowie bei Wortzusammensetzung und -modifikationen das generische Maskulinum zu Aussage und Abbildung von geschlechterübergreifenden Wirklichkeiten zu gebrauchen. Die Kirchengeschichtlerin Dorothea Wendebourg plädierte in der FAZ vom 18. 1. dafür, dass gerade „wir als Frauen das genus commune brauchen“, das heißt die grammatische Form, in der „die Gesamtheit der in einem Beruf, einer Funktion, einer Lebenslage verbundenen Menschen“ eingeschlossen sind. Sie verweist auf Frauen der ehemaligen DDR, die emanzipatorisch-stolz auf ihre damaligen Leistungen „als Ingenieure, Dreher oder Betriebsleiter“ sind oder als Frau Doktor gearbeitet haben. Dagegen sei die Rede von Ingenieurinnen- oder Ärztinnenberuf (mit oder ohne Genderstern) sachliche und sprachliche Irreführung, als wenn jene Berufe geschlechtsspezifisch wären.
Im Gegensatz zu den generisch-inklusiven Maskulin-Nomina stehen die Worte mit der Endsilbe -in. Sie sind sprachgesetzlich auf das Merkmal feminin festgelegt, also ‚markiert‘. Die Personalnomina Leserin, Beterin, Mieterin, aber auch Lieferantin, Redakteurin, Lektorin werden gebraucht, um eine einzelne weibliche Akteurin zu bezeichnen. Auch in der Pluralform sind unter der Anrede ‚liebe Christinnen‘ nur Frauen des christlichen Bekenntnisses zu verstehen – etwa in einer Versammlung der katholischen Frauengemeinschaft. Deshalb widerspricht der Satz: ‚Unter den Beterinnen von Lourdes sind nur wenige Männer‘ den Gesetzen der Sprache und der Logik. Denn unter den weiblich markierten ‚Beterinnen‘ können nicht zugleich männliche ‚Beter‘ gefasst werden.
Nach der gleichen Sprachregel ist es nicht möglich, das generische Pluralwort ‚die Christen‘ für die Gesamtheit der Gläubigen in der Kirche oder einer Gemeinde durch ‚die Christ(*)innen‘ zu ersetzen. Unter den ‚frühen Christen‘ zählten gleichermaßen männliche und weibliche Märtyrer zu den Opfern der römischen Christenverfolgung. Dagegen sind mit dem Genderwort Christ*innenverfolgung die männlichen Christen aus der verfolgten Christengemeinschaft ausgeschlossen. Daran ändert auch der Genderstern nichts, denn er steht nicht für das männliche Geschlecht. Analog sind in dem Wort Judenverfolgung Männer, Frauen und Kinder inkludiert. Durch die Genderverwandlung in Jüd*innenverfolgung werden jüdische Männer und Jungen nicht mehr als Opfer der Verfolgung angesehen – eine halbe Holocaustleugnung.
Die Genderaktivisten verheddern sich in den Widersprüchen, die aus den grammatischen Missverständnissen entstehen.
Seit Beginn der Genderdebatte monieren sie, dass beim generischen Maskulinum Frauen nur nachrangig mitgemeint seien. In radikaleren Kritikversionen spricht man vom (vermeintlichen) Ausschluss der Frauen bei jenen Genera. Dagegen wird in der Gendersternsprache genau das praktiziert, was man fälschlich dem generischen Maskulinum unterstellt.
Ein weitere Widersprüchlichkeit besteht darin: Grammatisch weibliche Substantive wie die Person, Arbeitskraft, Aushilfe oder Intelligenzbestie müssten nach dem Anspruch der vielbeschworenen Geschlechtergerechtigkeit eigentlich vermieden werden. Denn in der Lesart der Genderisten werden mit diesen Femininworten (in Verkennung des generischen Charakters) bevorzugt Frauen angesprochen und erst nachrangig Männer mitgemeint. Während sie die analoge sprachliche Konstellation bei den maskulinen Genera kritisieren, praktizieren sie das gleiche Muster bei den femininen Nomina, die sie sogar als Ersatz für das generische Maskulinum propagieren.
Im praktischen Sprachgebrauch werden die generischen Einzelworte intuitiv richtig gebraucht, indem die Bezeichnungen je nach Kontext einen Bedeutungsbezug auf Frauen oder Männer haben können – etwa bei dem Wort ‚die Niete‘. Unter dem Buchtitel ‚Nieten in Nadelstreifen‘ werden eher Männer verstanden. ‚Die Dumpfbacke‘ kann ebenso ein Mann sein wie ‚der Schelm‘ oder ‚der Scherzkeks‘ eine Frau. Dagegen wollen Genderfeministinnen die sprachpraktische Einsicht vom kontextuellen Bezug auf eines oder beide Geschlechter bei der unmarkierten Wortgruppen des generischen Maskulinums gegen alle Evidenz nicht wahrhaben.
Wie schon erwähnt, sind die aus Verben abgeleiteten Substantive auf -er wie Jäger, Sammler, Bauer, Schreiber genauso wenig geschlechtsspezifisch wie die das Handeln beschreibenden Tätigkeitsworte. Die Gattungs- oder Gruppenbezeichnungen können aber je nach realen Umständen auch auf das Geschlecht der Handelnden bezogen sein. Letzteres war in früheren Zeiten der Fall, als die Männer im öffentlichen Raum die meisten Tätigkeiten dominierten. In diesem Kontext wurden die genannten Nomina realitätsbezogen fast ausschließlich mit männlichen Personen konnotiert.
Nachdem seit Beginn der Neuzeit zunehmend Frauen in den ehemals männerdominierten Bereichen und Berufen tätig sind, kommt der immer schon generische Charakter jener Wortgruppe zum Tragen: Mit dem maskulinen Genus-Wort ‚Sammler‘ z. B. sind Menschen gemeint, die etwas sammeln, in bestimmten Kontexten auch jeweils Männer oder Frauen – etwa in dem Satz: ‚Die Sammler der Altsteinzeit waren meistens Frauen‘. Oder: ‚Die um Spenden bittenden Mädchen an der Haustür zeigten ihren Sammlerausweis.‘
Die Forderung nach stetiger gendersprachlicher Ausdifferenzierung in ‚der*die Sammler*in‘ oder ‚Sammler*innenausweis‘ ist so überflüssig wie ein Kropf. Darüber hinaus enthält dieser Gender-Neusprech auch einen falschen Realitätsbezug, als wenn es einen Tätigkeitsunterschied zwischen männlichem und weiblichem Sammeln und Jagen, Schreiben und Studieren gäbe (siehe auch das obige Beispiel vom vermeintlichen Ingenieur*innenstudium). Wenn der Duden uns neuerdings vorschreiben will, dass unter ‚Zeitzeugen‘ oder ‚Ladendieben‘ ausschließlich männliche Personen zu verstehen seien, so ist das weder grammatisch korrekt noch geschlechter- und realitätsgerecht. Wegen dieser welt- und sprachfremden Tendenz wird das Gendersprachprojekt ebenso wenig Bestand haben wie weiland die Mengenlehre an der Schule.
Zum Schluss seien ein paar karnevaleske Auswüchse der Gendersternsprache bei Komposita aufgeführt. Solche Wortkonstrukte wie Bürger*innenmeister*in, Ladendieb/innenstahl oder Außenarchitekt:innen sind ebenso lächerlich wie LKW-FührerInnenhaus und Außenvertreter_innen. In der Fastnachtsausgabe des Heutejournals möchten Petra Gerster und Claus Kleber ankündigen, dass Chef*innenredakteur*innensprecher*innen das Ruder auf dem Narr*innenschiff ZDF übernehmen.
Die Genderisten haben sich in eine sprachpolitische Sackgasse verrannt.