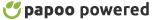14.10.2025
Das Konkordat von 1933 als Defensivvertrag gegen den NS-Staat (Schwarze Legenden II)
Der deutsch-vatikanische Staatsvertrag des Konkordats von 1933 bedeutete für die Kirche eine Festschreibung der „Nicht-Anpassung“ an den NS-Staat und diente der Abwehr von dessen totalitärem Anspruch.
Die zentrale israelische Holocaustgedenkstätte Yad Vaschem stellt die öffentliche Behauptung in den Raum, Eugenio Pacelli, der später Papst Pius XII., habe mit seiner Unterschrift unter den Konkordatsvertrag zwischen dem Heiligen Stuhl und dem Deutschen Reich im Juli 1933 die „Anerkennung des rassistischen Nazi-Regimes“ betrieben.
Im folgenden Beitrag wird erwiesen, dass diese These weder historische noch systematische Evidenz beanspruchen kann und deshalb als Verleumdung von Papst und Kirche betrachtet werden muss. Die Falsch-Interpretation des Konkordats wird auch an dem aktuellen Vergleich deutlich: Die Unterschrift der israelischen Regierung unter die aktuelle Vereinbarung mit der Hamas zum Kriegsende in Gaza bedeutet ja auch nicht, dass Netanjahu das „terroristische Hamas-Regime“ anerkennt.
I.
Das Konkordat zwischen Vatikan und Deutschem Reich vom Juli 1933 stand in einem innenpolitischen Kontext.
Adolf Hitler regierte nach seiner Ernennung zum Reichskanzler durch Reichspräsident Hindenburg am 30. Januar 1933 als Chef einer Minderheitskoalition mit Notstandsverordnungen wie die drei bürgerlichen Kanzler vor ihm. Mit diesen gesetzlichen Instrumenten wurden scharfe Unterdrückungsmaßnahmen durchgeführt, zunächst gegen Kommunisten, bald darauf auch gegen Juden sowie linke und bürgerliche Opposition in Reich, Länder und Kommunen. Mit weiteren Übergriffen und Gewaltdrohungen gegen Gewerkschaften, Kirchen und zivilgesellschaftliche Vereinigungen sollten deren Gleichschaltung erzwungen werden.
Gleichzeitig machte Hitler Zugeständnisse an alle Oppositionsgruppen für eine nationale Einheitsbewegung. In seinem Aufruf an das deutsche Volk vom 1. Februar 1933 bestimmte er „das Christentum als Basis unserer gesamten Moral“ und die Familie als Keimzelle des Volks- und Staatskörpers. In der Regierungserklärung vom 23. März zum Ermächtigungsgesetz garantierte der Kanzler den Kirchen Schutz und rechtliche Unantastbarkeit sowie den Erhalt aller Verfassungsorgane.
Sechs Wochen später überzeugte Kanzler Hitler mit seiner programmatischen Regierungserklärung vom 17. Mai auch die Liberalen und Sozialdemokraten: Schutz der Eigentumsordnung im neuen Volksstaat, Wirtschaftsaufschwung und Arbeitsplätze, nach außen Revision des Versailler Vertrags und Gleichberechtigung Deutschlands im Rahmen friedlicher Verhandlungen und Verträge. Der damalige Reichstagsabgeordnete und spätere Bundespräsident Theodor Heuss stimmte mit seinen liberalen DStP-Kollegen genauso für die NS-Resolution zur „Friedensrede“ Hitlers wie die anwesenden Mitglieder der SPD-Fraktion. Nach deren Überzeugung hätte auch der ehemalige Außenminister und Friedensnobelpreisträger Gustav Stresemann „eine sanftere Rede für Frieden und Völkerverständigung nicht halten“ können.
II.
In diesem innenpolitischen Klima der Drohung zur Anpassung einerseits sowie der „Versöhnung zur nationalen Einigung“ andererseits durch Ansage substantieller Zugeständnisse fanden die Verhandlungen zum Konkordat statt.
• Die vorangegangenen Verhandlungen des Vatikans mit Regierungen der Weimarer Republik über einen Staatsvertrag zur Rechtssicherheit der Kirche scheiterten u. a. wegen der staatlichen Ablehnung von katholischen Bekenntnisschulen und Religionsunterricht an öffentlichen Schulen. Dagegen machte Hitler bei seiner Ermächtigungsgesetzrede sowohl ein allgemeines „Friedensangebot“ für die Rechte und Autonomie der Kirche sowie auch Konzessionsandeutungen zu den oben erwähnten strittigen Punkten.
• Die Initiative zur Konkordatsverhandlung ging nicht vom Vatikan aus, sondern von der Reichsregierung. Kanzler Hitler betrieb seit der „Machtergreifung“ am 30. Januar 1933 eine Kurskorrektur bezüglich der vorherigen kirchenfeindlichen NS-Politik. Seine neue Strategie war es, mit Rechtszusagen an die Kirche die bisher NS-kritischen Katholiken für die große nationale Aufbruch- und Aufbaubewegung zu gewinnen. Ein ähnliches Zugehen zeigte er auch gegenüber den anderen gesellschaftlichen Großgruppen wie Liberalen und Sozialdemokraten (siehe oben).
• Der vatikanische Verhandlungsführer, Staatssekretär Eugenio Pacelli, bot dem deutschen Delegationsleiter von Papen als Gegenleistung für die schulpolitischen Konzessionen an, die politischen Betätigungsmöglichkeiten des Klerus in vatikanischer Regie kirchenrechtlich einzuschränken. Doch Hitler bestand auf einem Totalverbot. Schließlich einigte man sich auf den Vertragstext, dass der Vatikan Bestimmungen erlässt, nach denen „Geistlichen die Mitgliedschaft in politischen Parteien und die Tätigkeit für solche Parteien“ untersagt ist. Nach der Selbstauflösung des Zentrums im Juni 1933 war das Verbot in dieser Hinsicht nicht mehr relevant, galt aber noch für die NS-Partei. Allerdings war aufgrund des vorherigen Distanz-Verhältnisses nur ein Promille-Anteil von katholischen Geistlichen Mitglied der NSDAP.
• Nach den mannigfache Gewaltaktionen der NS-Organisationen gegen katholische Vereine und insbesondere nach dem offenen Straßenterror gegen den Münchener Gesellentag des Kolpingwerks im Juni 1933 bestanden die Bischöfe auf Schutzgarantie für kirchliche Verbände bei nicht-politischer Tätigkeit im „religiösen, kulturellen und karitativen Bereich“. Der Artikel 31 bewahrte den Verbandskatholizismus vor der Gleichschaltung.
• Das Konkordat schützte in vielen Bereichen die überkommenen Rechte und Autonomie der Kirche. Es bedeutete in vertragsrechtlicher Form eine Festschreibung der kirchlichen Resistenz und „Nicht-Anpassung“ (Konrad Rebgen) an den NS-Staat sowie der Abwehr von dessen totalitärem Anspruch.
III.
Diese Einschätzung bestätigten die nicht wenigen Stimmen aus dem NS-Lager, die im Konkordat inakzeptable Zugeständnisse der Staatsseite bemängelten und in den Folgejahren die einseitige Aufkündigung durch die NS-Regierung einforderten.
Trotz der vielen NS-Vertragsverstöße behielt das Konkordat für die Kirche des „Altreichs“ seine grundlegende Schutzfunktion, während die Nazis in den seit 1938 hinzugewonnenen oder eroberten Gebiete eine ungehemmte Unterdrückung des kirchlichen Lebens durchsetzten: In Österreich wurden im Sommer 1938 alle Klöster- und Bistumsschulen geschlossen, im Sudetengau zusätzlich Bischofsitze, Klöster und Pfarreigentum beschlagnahmt. Im 1939 eroberten und „germanisierten“ Warthegau wurden die kirchlichen Strukturen vollständig zerschlagen - als Exempel für die geplante Vernichtung der Kirche in Deutschland nach dem Krieg.
Bei der Konstituierung des Grundgesetzes wurde das Konkordat im Artikel 123 implizit als weiterhin gültiger Vertrag anerkannt. Das geschah einerseits wegen der völkerrechtlichen Fortgeltung, aber auch, weil die meisten Konkordatsbestimmungen, die schon in der Weimarer Republik konzipiert worden waren, der freiheitlichen Grundordnung der Bundesrepublik entsprachen, wie etwa der einleitende Artikel 1: „Das Deutsche Reich gewährleistet die Freiheit des Bekenntnisses und der öffentlichen Ausübung der katholischen Religion“ – vgl. Artikel 4 des Grundgesetzes.
Resümee:
Das Reichskonkordat vom 20. Juli 1933 war unter den Bedingungen der kirchenfeindlichen Ansage des Nationalsozialismus, der sich seit Ende Januar 1933 als Staatsmacht mit totalitären Tendenzen zeigte, ein wichtiges Rechtsinstitut, das den impliziten und seit 1936 immer deutlicher zutage tretenden NS-Vernichtungswillen gegenüber der Kirche verzögern und in Grenzen halten konnte.
Wie bei jedem der über 40 zwischenstaatlichen Verträge der Hitlerregierung vor dem 20. Juli 1933 implizierte auch der Konkordatsabschluss mit dem Vatikan eine gegenseitige Anerkennung der staatlichen Vertragspartner, allerdings nur im formaljuristischen Sinne. Eine inhaltliche oder gar moralische Anerkennung der politischen Richtung des Nationalsozialismus‘ mit dem Konkordat zu verbinden, ist eine unzulässige Überinterpretation eines zwischenstaatlichen Vertrages. Ausdrücklich wies der vatikanische Verhandlungsführer, Staatssekretär Eugenio Pacelli, eine solchen politische Deutung des Konkordats in zwei Beiträgen im L‘Osservatore Romano zurück. Deshalb ist der verbreitete Vorwurf an den Vatikan, übernommen auch von Yad Vashem, er habe mit dem Vertragsabschluss „die Anerkennung des rassistischen Nazi-Regimes betrieben“, eine sachlich unbegründete und daher verleumderische Anklage.
Da die israelische Holocaust-Gedenkstätte nicht auch die anderen 25 damaligen staatlichen Vertragspartner des Deutschen Reichs mit dem gleichen Vorwurf der Anerkennung des NS-Rassismus konfrontiert, macht sie sich gegenüber dem Vatikan der Anwendung eines Doppelstandards schuldig - ein Vorgehen, das der heutige Staat Israel gegenüber seinen Kritikern mit Vehemenz zurückweist.
Hubert Hecker